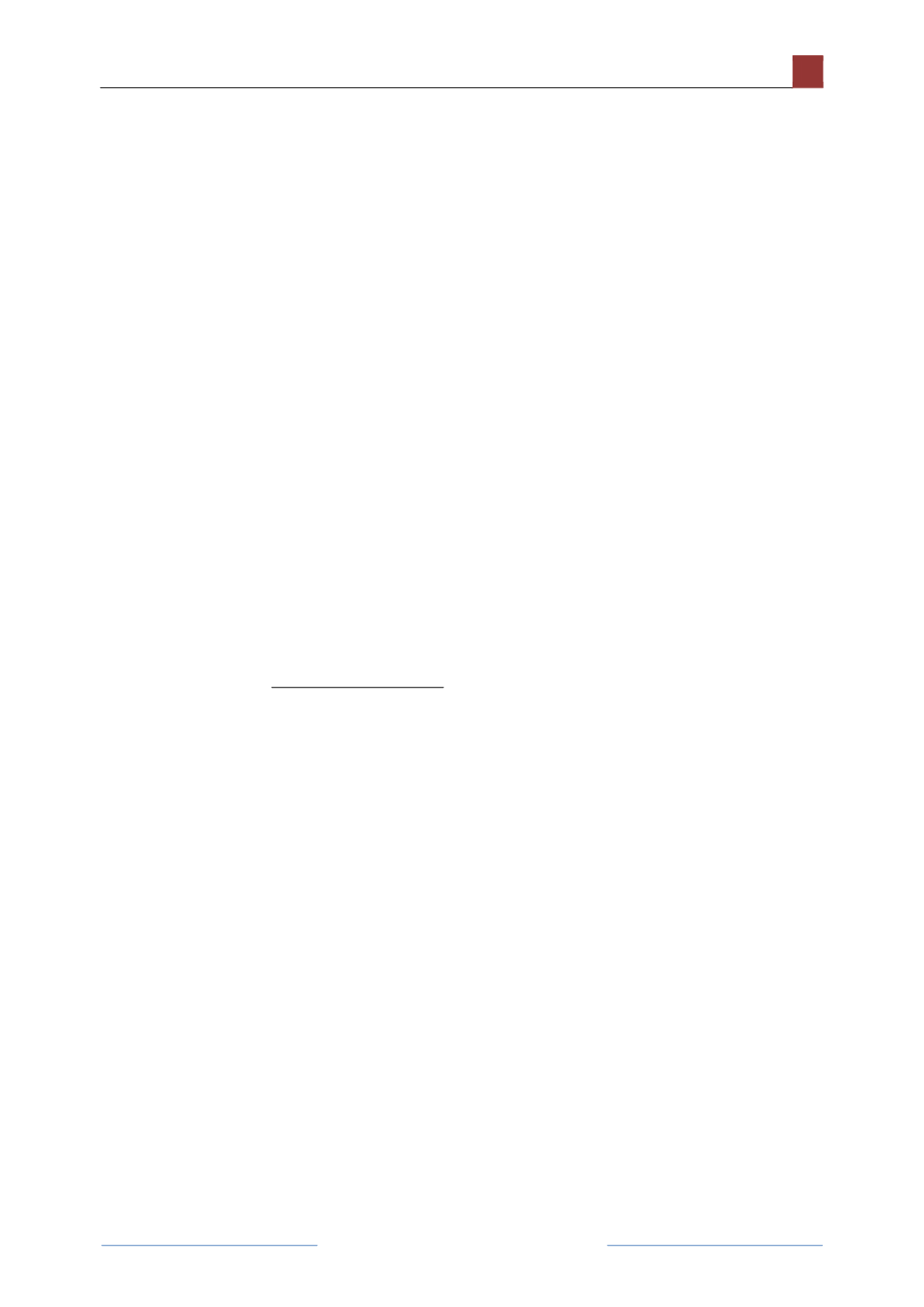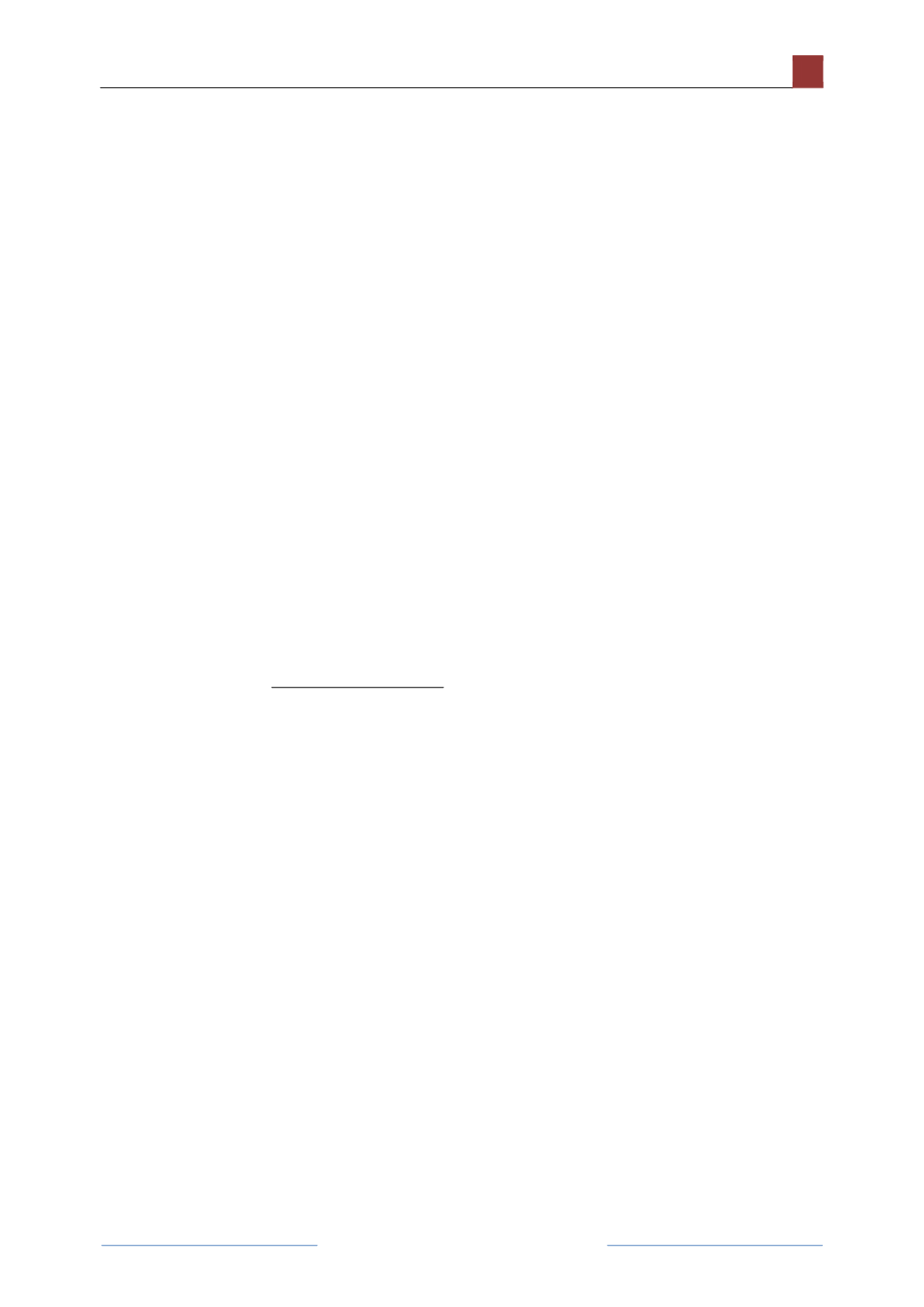
FM - Wahrnehmung
47
©
aon gmbh – academy of neuroscience
Leistungen führen. Hierzu gehören beispielsweise die Wahrnehmung der Lautstärke, die Lokalisation
eines Schallereignisses im Raum, die Frequenz- bzw. Tonhöhenunterscheidung, die Kombination von
Tönen und Klängen zu Melodien sowie das Zusammenfügen von Lautstrukturen zu bedeutungsvollen
Wörtern und Sätzen. Personen können wir anhand des Klanges ihrer Stimme identifizieren.
In ihren Anfängen gingen die physiologische Akustik und die Psychoakustik von der Vorstellung einer
passiven Informationsaufnahme durch den Gehörsinn aus. Daher stand die Analyse des peripheren
Gehörs als eines passiven Filtersystems im Vordergrund. Vielfach waren es zuerst Physiker, Mathematiker
und Ingenieure, die Modellvorstellungen über die Funktionsweise des Ohres entwickelten. Als Aufgabe
des Gehirns wurden daher die Reduktion des Informationsflusses, die Verschärfung der Wahrnehmungs-
leistungen und die Kombination einzelner Komponenten zu komplexen Wahrnehmungen angesehen. Die
klassischen Modellvorstellungen gipfelten in seriell-hierarchischen Detektorkonzepten. Man ging dabei
von der Annahme aus, dass das Ohr als peripheres Filtersystem die für den Empfänger wichtigen Signale
durchlässt und in einer Reihe von hintereinander angeordneten Schritten die Information herausgearbeitet
wird. An der Spitze dieser Prozesse stünde ein Detektor, der bestimmte Eigenschaften des Signals
erkenne. Durch immer leistungsfähigere, interdisziplinär angewandte Untersuchungsmethoden der
Biophysik, Biochemie, Neuroanatomie, Elektrophysiologie, Psychophysik und Neurolinguistik, durch
theoretische Modellierungen sowie nicht zuletzt durch die neuen bildgebenden Verfahren hat sich aber
auch hier das Bild von einer „Informationsverarbeitung“ gewandelt. Heute wird der Prozess des Hörens
als ein strukturierender, bedeutungsgenerierender Vorgang angesehen, bei dem das Ohr und das Gehirn
zusammen aktiv die Hörempfindung hervorbringen. Sowohl die Analyse einfacher Schallsignale als auch
die komplexer akustischer Situationen (Szenarien) wird entsprechend den Eigenschaften des gesamten
Hörsystems durchgeführt.
4.1 Physik des Schalls
Schall entsteht durch Molekülschwingungen eines elastischen Stoffes (Luft, Wasser, Knochen etc.), die
durch einen schwingenden Festkörper (z.B. Stimmgabel, Saiten eines Musikinstruments, Stimmbänder
des Kehlkopfes) ausgelöst werden. Die schwingenden Teilchen übertragen ihre Energie auf benachbarte
Moleküle, wodurch sich der Schall wellenförmig fortpflanzt. Genau genommen handelt es sich um
Druckschwankungen, die sich im Raum ausbreiten, da die oszillierenden Körper gegenüber dem
ruhenden Medium jeweils einen Über- bzw. Unterdruck des schallübertragenden Mediums erzeugen. Die
Ausbreitungsgeschwindigkeit einer Schallwelle beträgt in der Luft ca. 340 m/s, im Wasser ca. 1400 m/s.
Die Dauer einer einzelnen Schwingung ist die Periodendauer (T), aus der sich die Frequenz errechnen
lässt: