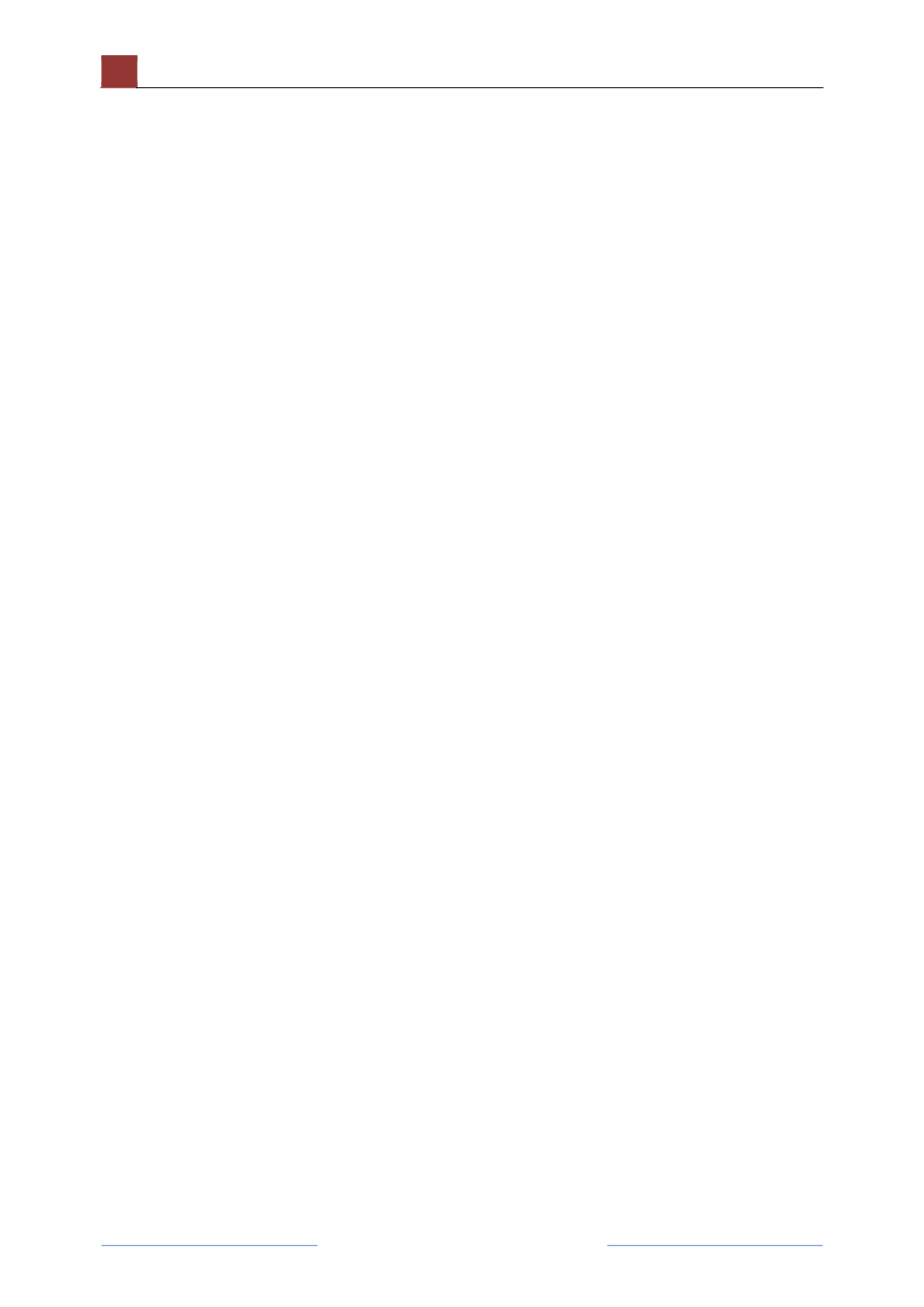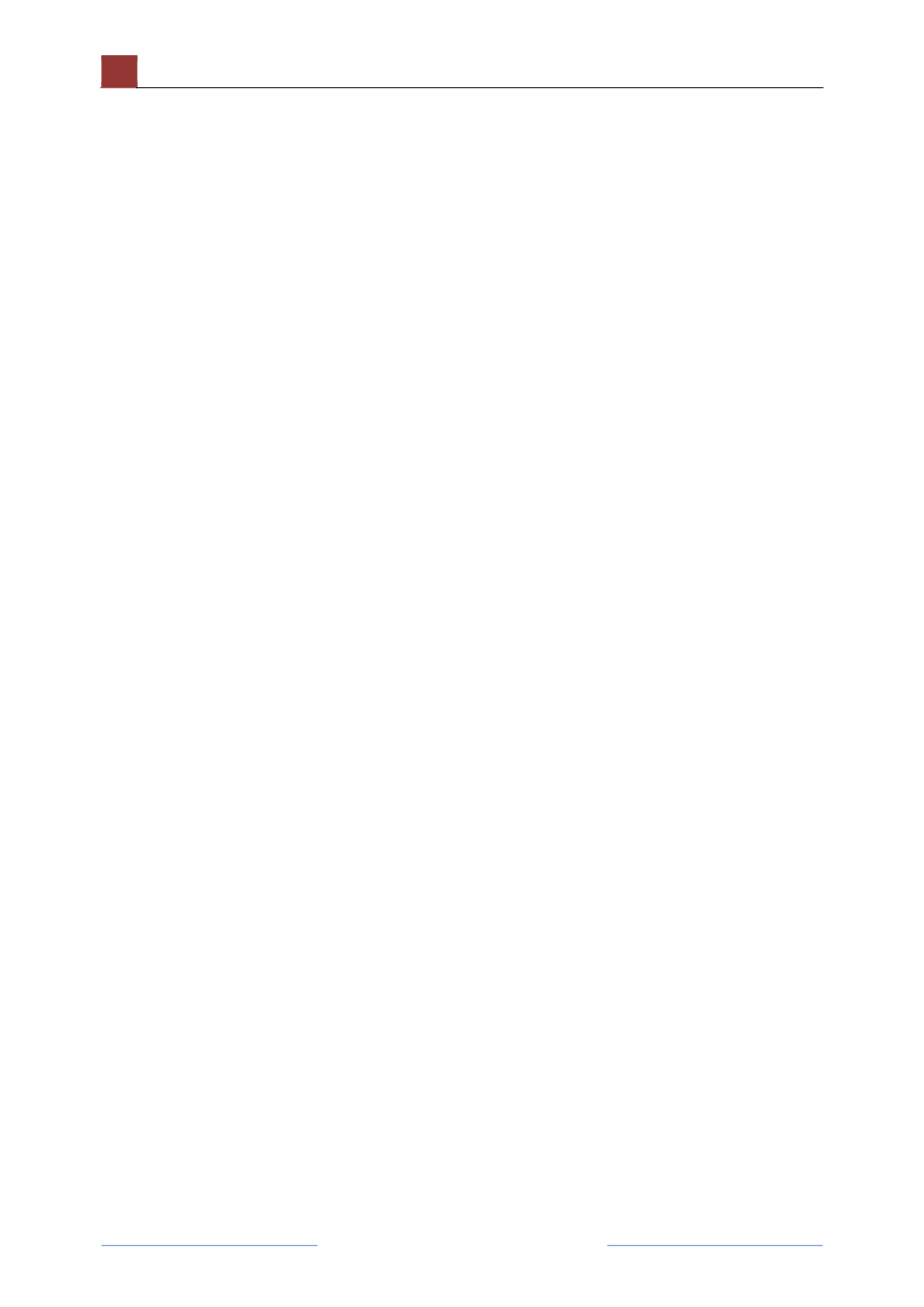
50
FM - Wahrnehmung
©
aon gmbh – academy of neuroscience
4.2 Der Bau des auditorischen Systems
Das Ohr der Säugetiere gliedert sich in drei Abschnitte: das Außenohr, das Mittelohr und das Innenohr
(Abb. 4.2 a). Die eigentlichen Hörrezeptoren finden sich im Innenohr in der Schnecke (Cochlea). Bevor die
Schallwellen die Sinneszellen erreichen, passieren sie eine Reihe von Hilfsstrukturen. Das Außenohr, das
beim Menschen aus der Ohrmuschel, dem Ohrläppchen und dem äußeren Gehörgang besteht, wirkt als
Schallfänger.
Von der Ohrmuschel gelangen die Schallwellen über den äußeren Gehörgang zum Trommelfell
(Tympanum), welches das äußere Ohr gegen die Paukenhöhle des Mittelohres abschließt. Über die mit
dem Mundraum verbundene Eustachische Röhre (Tuba auditiva) kann die Paukenhöhle - beispielsweise
beim Schlucken - unterschiedlichen Druckverhältnissen angepasst werden. Das Trommelfell ist eine straff
aufgehängte, äußerst dünne Membran, die durch die Druckschwankungen des Luftschalls in Schwin-
gungen versetzt wird. Diese werden von den hintereinander angeordneten Gehörknöchelchen zum
Innenohr weitergeleitet. Säugetiere besitzen drei Gehörknöchelchen: Hammer (Malleus), Amboss (Incus)
und Steigbügel (Stapes), welche durch kleine Bänder an den Wänden des Mittelohres in der Schwebe
gehalten werden. Zudem sind sie so konstruiert, dass sie nahezu schwerelos um ihren Schwerpunkt
schwingen können. Zwei kleine Muskeln beeinflussen die Schwingungseigenschaften der Gehör-
knöchelchen. Der vom fünften Hirnnerven (Nervus trigeminus) innervierte Musculus tensor tympani setzt
am Hammerstiel an. Der Musculus stapedius greift am Steigbügel an, er wird vom siebten Hirnnerven,
dem Nervus facialis versorgt. Beide Muskeln üben eine Schutzfunktion aus. Bei lauten Schallereignissen
kontrahieren sie sich reflexartig und verändern dadurch sowohl die Spannung des Trommelfells als auch
die Übertragungsamplitude der Gehörknöchelchenkette. Insbesondere niederfrequente Schallereignisse
(< 2 kHz) werden abgeschwächt, wodurch eine Verbesserung der Wahrnehmung höherfrequenter Anteile
erreicht wird. Der Reflex ist allerdings zu langsam, um vor explosionsartigem Schall zu schützen.
Das Innenohr besteht aus dem häutigen Labyrinth, welches in das sehr harte, knöcherne Felsenbein
(knöchernes Labyrinth) eingelagert ist. Es setzt sich aus bläschenartigen Erweiterungen, dem Vestibulum,
den Bogengängen und dem Schneckengang, dem Ductus cochlearis (Abb. 4.2 b, c), zusammen, in dem
das eigentliche Gehörorgan, das Cortische Organ, liegt. Knöchernes und häutiges Labyrinth sind durch
einen mit Flüssigkeit gefüllten Raum, der Perilymphe, getrennt. Der Ductus cochlearis ist bei den
Säugetieren in einem Teil des knöchernen Labyrinths eingelagert, der auf Grund seiner Form als
Schnecke (Cochlea) bezeichnet wird. Die Länge der Cochlea ist artspezifisch, beim Menschen erreicht sie
zweieinhalb Windungen. Zum Mittelohr hin öffnet sich das knöcherne Labyrinth über zwei Fenster: in das
ovale Fenster greift der Fuß des Stapes, das runde Fenster ist durch eine dünne Membran (Membrana
tympanica secundaria) abgedeckt.