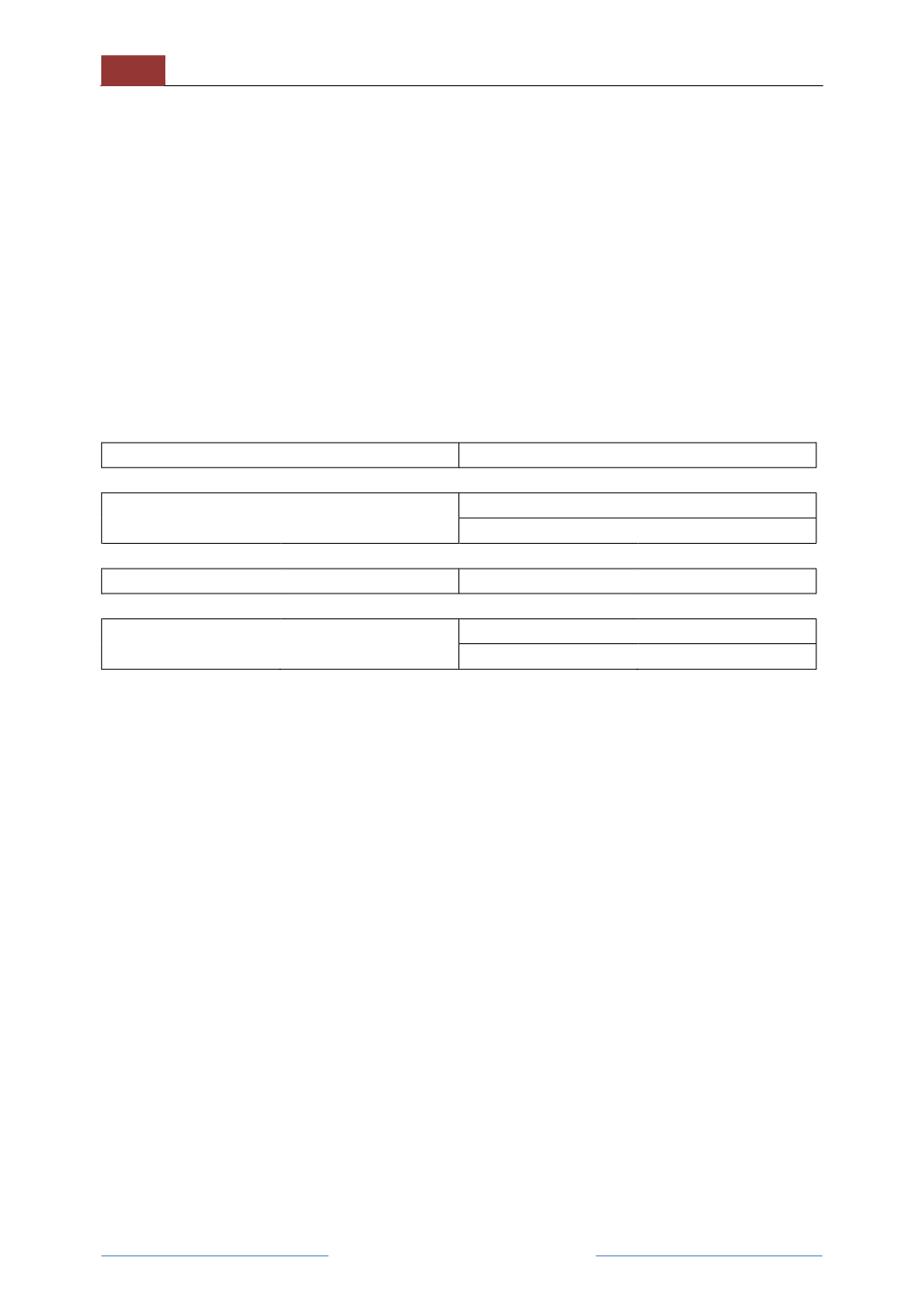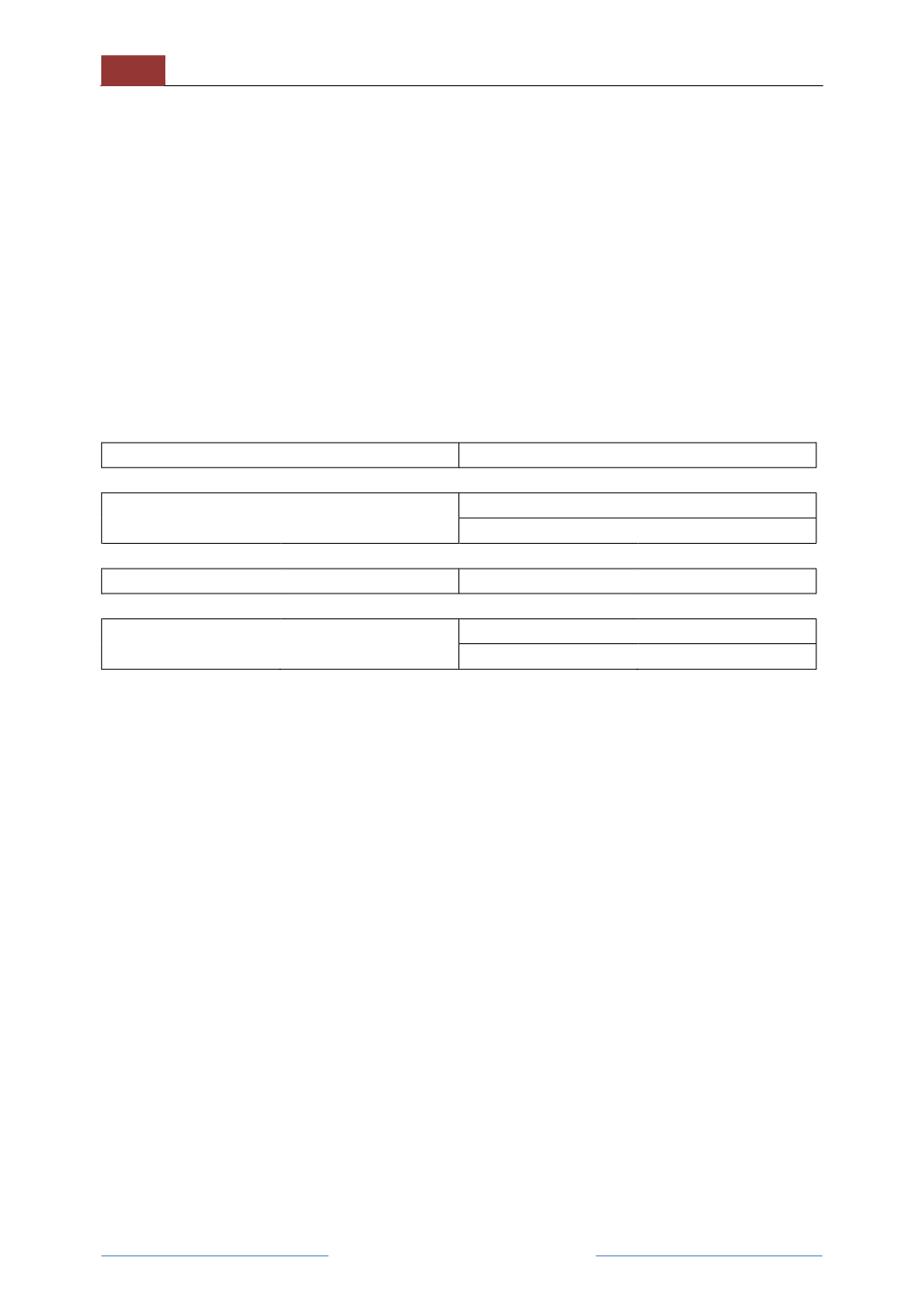
44
BM – Grundlagen der Neurowissenschaften
©
aon gmbh – academy of neuroscience
Das Wissen um die Entwicklungsgeschichte hilft, ein bisher unbekanntes Land besser verstehen zu
können. Bei einem Gehirn verhält es sich ähnlich. Wenn man weiß, wie sich ein Gehirn entwickelt, kann
man seine Architektur leichter verstehen. Bei einem Wirbeltier-Embryo entsteht zunächst ein mit
Flüssigkeit gefülltes Neuralrohr. Am Kopfende bilden sich drei Verdickungen, drei Hirnbläschen. Aus
diesen entwickeln sich später das Vorderhirn (Prosencephalon), das Mittelhirn (Mesencephalon) und das
Rautenhirn (Rhombencephalon), das in das Rückenmark übergeht. Das Vorderhirnbläschen teilt sich
später und formt das Zwischenhirn (Diencephalon) und das End- oder auch Großhirn (Telencephalon).
Auch das hintere Hirnbläschen teilt sich: Aus dem Rhombencephalon werden das Hinterhirn
(Metencephalon) und das Nachhirn (Myelencephalon, auch Medulla oblongata genannt). Ein
ausgewachsenes Wirbeltier-Gehirn besteht also aus folgenden fünf Abschnitten:
Embryonale Hirnbläschen
Ausgewachsene Hirnabschnitte
Vorderhirn
Prosencephalon
Großhirn
Telencephalon
Zwischenhirn
Diencephalon
Mittelhirn
Mesencephalon
Mittelhirn
Mesencephalon
Rautenhirn
Rhombencephalon
Hinterhirn
Metencephalon
Nachhirn
Myelencephalon
Beim Menschen und auch bei anderen Wirbeltieren weist das Telencephalon während der
Gehirnentwicklung das stärkste Wachstum auf. Es kann so groß werden, dass es die anderen Bereiche,
die in ihrer Gesamtheit auch als Hirnstamm bezeichnet werden, nahezu völlig überdeckt. Bei den
Säugern wird oft noch eine 6. Hirnstruktur unterschieden, nämlich die Brücke (Pons), die den Boden des
Hirnstamms umfasst.
Im Gehirn befinden sich vier große, mit Liquor gefüllte Kammern, die cerebralen Ventrikel. In ihrer
Gesamtheit ähnelt die Form ein wenig an das Gerüst eines Sattels. Die Hirnventrikel stehen mit dem
Subarachnoidalraum und dem Zentralkanal des Rückenmarks in Verbindung. Je ein Seitenventrikel
befindet sich in jeder Großhirnhälfte, der drittel Ventrikel liegt im Zwischenhirn, und der vierte Ventrikel im
Rautenhirn. Sie stehen über Löcher, Foramina genannt, und über Kanäle miteinander in Verbindung.
5.2.5
Die Blut-Hirn-Schranke
Ein wichtiger und geläufiger Begriff ist die Blut-Hirn-Schranke. Anders als man vielleicht erwartet, ist damit
jedoch kein Gegenstand, sondern ein Mechanismus gemeint. Zur Hauptaufgabe der Blut-Hirn-Schranke
gehört, den Übertritt potenziell pathogener oder giftiger Substanzen aus dem Blutstrom ins Gehirn zu
verhindern und Abbauprodukte aus dem Hirngewebe in die Blutbahn zu transportieren. Das
Regenerationsvermögen und Selbstheilungspotenzial des Hirngewebes ist nämlich dem der meisten
anderen Organe und Gewebe weit unterlegen. Aus diesem Grund erreichen Verletzungen, Störungen und