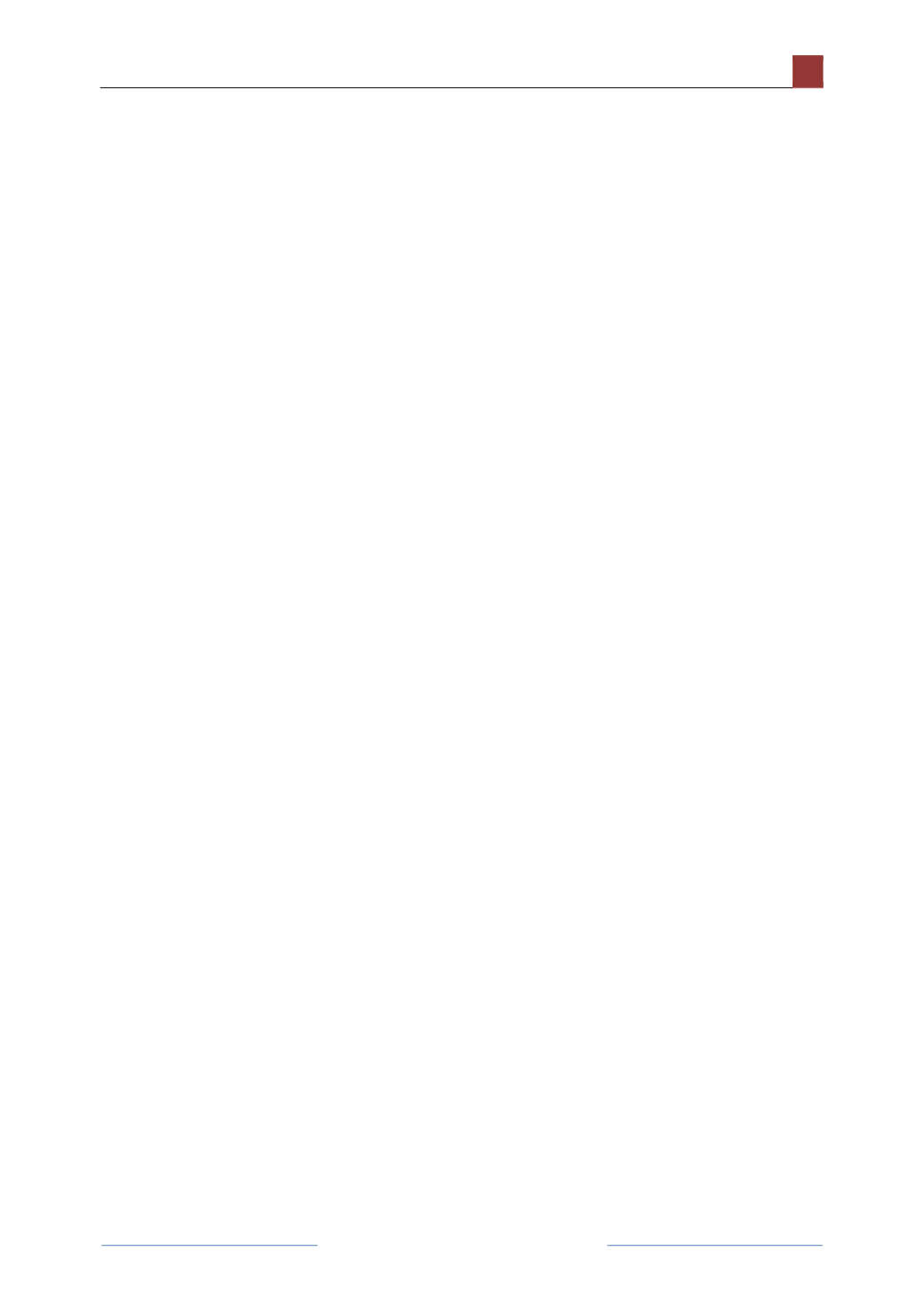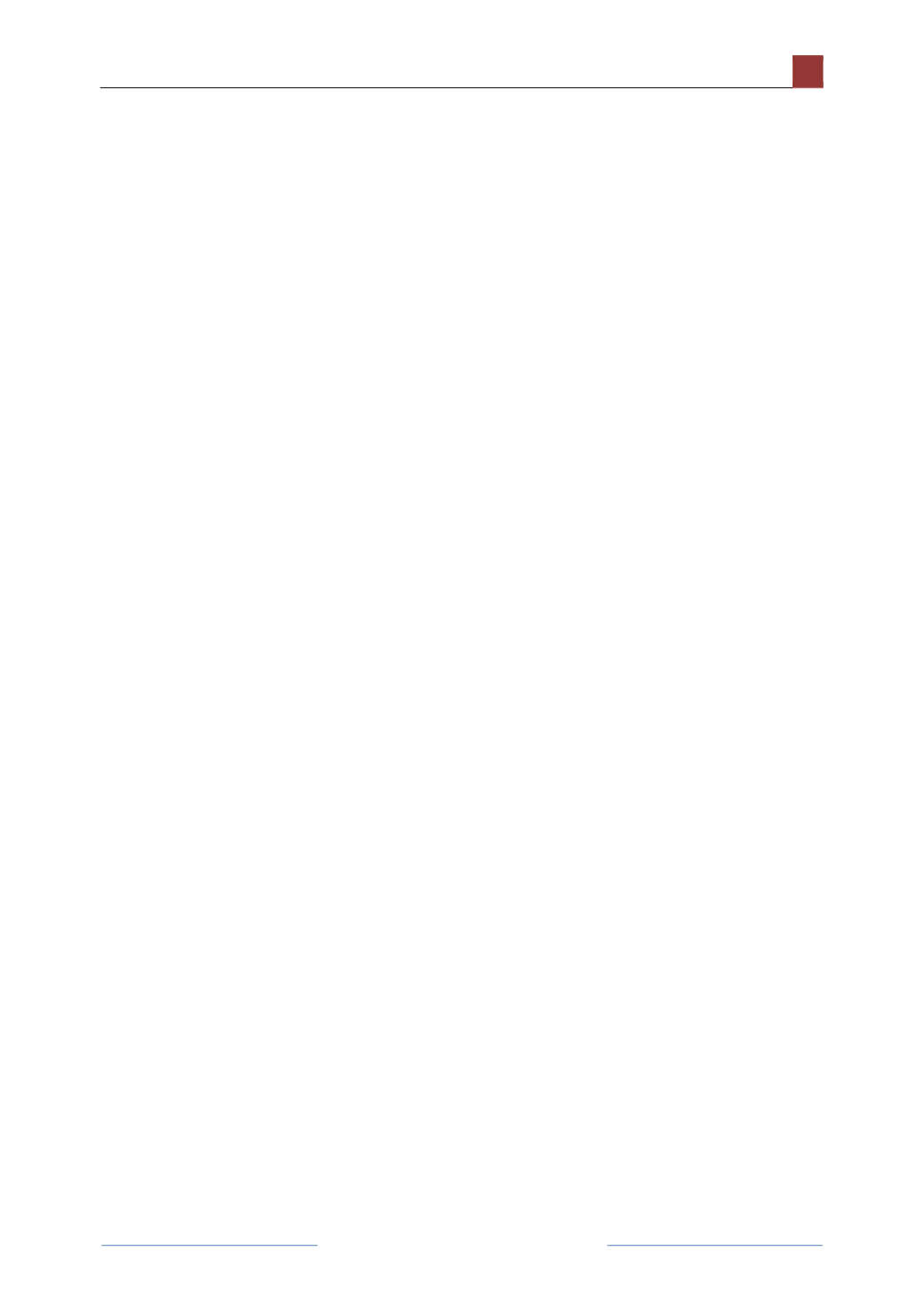
FM - Wahrnehmung
67
©
aon gmbh – academy of neuroscience
Wie oben ausgeführt, dominiert bei den meisten Menschen die linke Hemisphäre des Cortex bezüglich
der Sprachwahrnehmung. Anders verhält es sich bei der Wahrnehmung von Musik. Bei Untersuchungen
zur Fähigkeit, Melodien zu erkennen, Akkorde und Klangfarbe zu unterscheiden, zeigte sich die Dominanz
der rechten Hemisphäre. Bestätigt wurde dies durch die Analyse der Ausfallserscheinungen bei
Hirnschlagpatienten. Solche mit Schädigungen des rechten Temporallappens wiesen große Defizite bei
den oben genannten Leistungen auf, während solche, bei denen der linke Temporallappen betroffen war,
in ihrer Fähigkeit, Musik wahrzunehmen, nicht oder kaum eingeschränkt waren. Sie hatten allerdings
Probleme, die Melodien zu benennen, da ihre verbalen Leistungen eingeschränkt waren. Aber auch der
linke Cortex ist an der Verarbeitung von Musik, insbesondere an der Wahrnehmung von Harmonien und
kurzen Melodieabschnitten beteiligt. Die Fähigkeit, den Rhythmus zu erkennen, wird durch Läsionen in
beiden Hemisphären reduziert.
Nicht nur für die Wahrnehmung von Musik, sondern auch für die Produktion von Musik konnte gezeigt
werden, dass den beiden Hirnhälften unterschiedliche Aufgaben zukommen. Bereits gegen Ende des 19.
Jahrhunderts war der Fall eines geschulten Sängers bekannt geworden, dessen rechter vorderer Cortex
verletzt wurde. Nach dem Unfall war er nicht mehr in der Lage zu singen, zu pfeifen und einen Ton zu
halten. Ein anderer Patient, ein Orgelspieler, hatte eine beidseitige Schädigung des auditorischen Cortex
erlitten. Auf der linken Seite waren der mittlere und hintere Bereich des Heschl Gyrus betroffen, auf der
rechten Seite größere Bereiche des Temporallappens. Neben der Empfindlichkeit des Gehörs im unteren
und oberen Hörbereich büßte er die Tonhöhen- und Rhythmuswahrnehmung ein. Die Orgel konnte er
dennoch spielen, seine Fähigkeit der Erkennung von Melodien war allerdings reduziert.
Auch bei einigen berühmten Komponisten führten Hirnläsionen zu Verlusten ihrer musikalischen
Fähigkeiten. So litt der französische Komponist Maurice Ravel in den letzten vier Jahren seines Lebens an
einer degenerativen Hirnerkrankung die zu einer Wernicke-Aphasie führte. Seine Fähigkeit der
Tonhöhenunterscheidung war davon allerdings nicht betroffen. Er erkannte Melodien und entdeckte
Kompositionsfehler ohne Schwierigkeiten. Er hat jedoch große Schwierigkeiten beim Lesen von Noten
und war nicht länger in der Lage, neue Kompositionen zu schaffen. Ein anderer Fall war der des
russischen Komponisten Vissarion Shebalin, der ebenfalls nach einem Hirnschlag in der linken
Hemisphäre aphasisch wurde. Er konnte im Gegensatz zu Ravel jedoch weiterhin komponieren, und
seine Werke galten im Urteil der Zeitgenossen (z.B. Dimitri Shostakovich) als ebenso brilliant wie die,
welche er vor der Erkrankung geschaffen hatte.
Ableitungen des EEG’s oder Stoffwechselmessungen, beispielsweise mittels Positronen-Emmissions-
Tomographie (PET) erlauben Aussagen über die neuronale Repräsentation von Musik im Gehirn gesunder
Versuchspersonen beim passiven Musik Hören. Darüber hinaus haben sie gegenüber den oben
genannten Verfahren der Vorteil der größeren zeitlichen bzw. räumlichen Auflösung. Letztendlich
unterstützen jedoch auch sie die genannten Befunde, dass der rechten Hemispäre eine führende Rolle